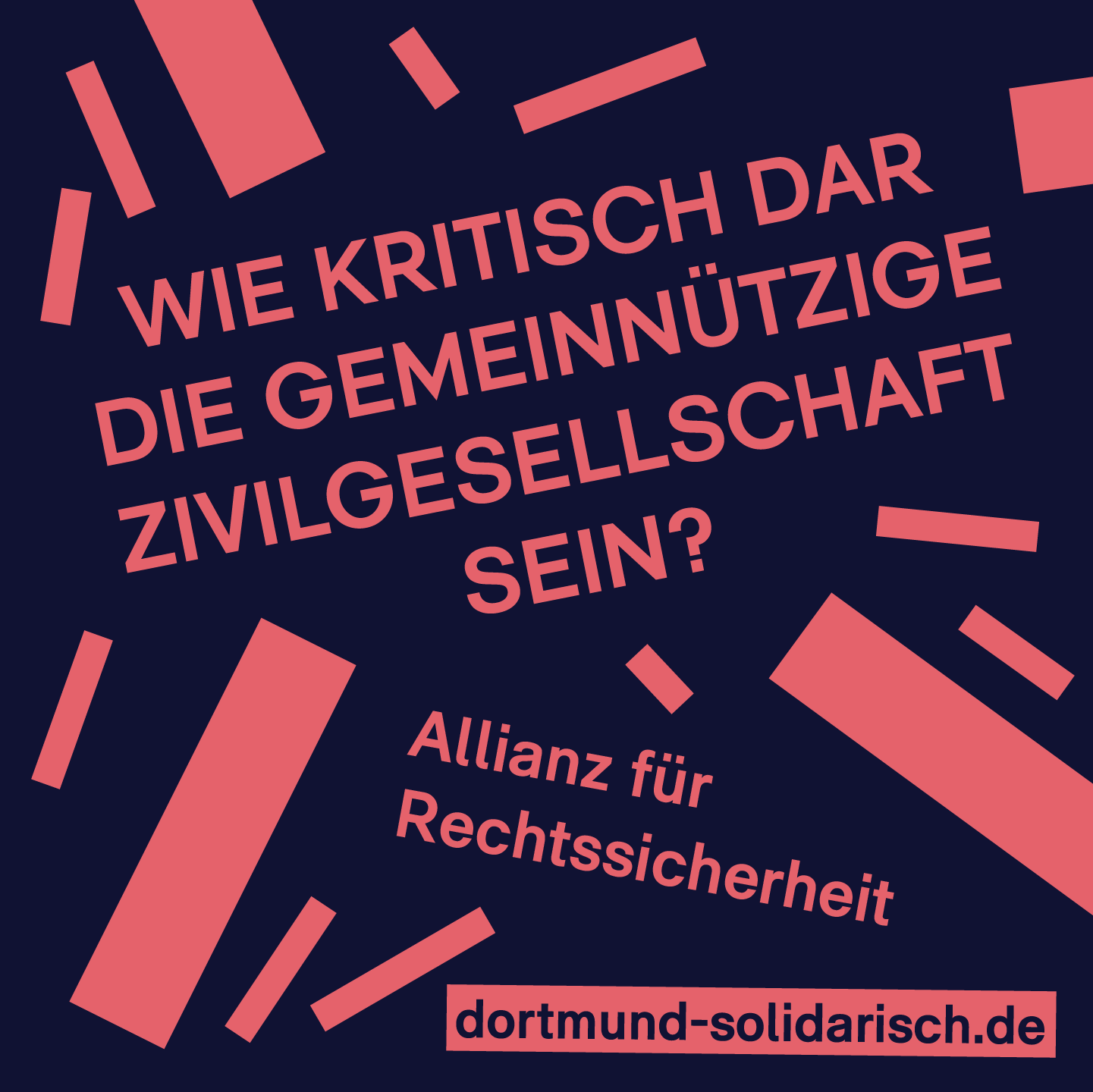Dieser Artikel ist Teil unserer Zeitung zur Kommunalwahl 2025.
Autor*in: Stephanie Handtmann – Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“
Gemeinnützige Vereine, die sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzen, geraten zunehmend unter Druck. Beispielhaft dafür steht die berühmt-berüchtigte Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion, mit 551 detaillierten Fragen zur Arbeit von 17 zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die Zusammenstellung dieser NGOs wirkt erratisch – von Greenpeace und der Deutschen Umwelthilfe über Attac und die Neuen Deutschen Medienmacher*innen bis hin zu den Omas gegen Rechts ist alles dabei: kleine und große, eher lose strukturierte und fest etablierte, gemeinnützige und nicht gemeinnützige. Als gemeinsamer Nenner lässt sich wohl festhalten: Diese Organisationen gehen der Union aus irgendeinem Grund anscheinend furchtbar auf die Nerven.
Kulturkampf auf dem Rücken einer kritischen Zivilgesellschaft
Bemerkenswert war auch die Tonalität der Anfrage: Das Raunen von „finanziellen Schattenstrukturen“ und einem „Deep State“ erfüllt primär den Zweck, als kritisch wahrgenommene zivilgesellschaftliche Organisationen zu diffamieren und zu delegitimieren. Eine solche Herangehensweise kennen wir von der AfD. Dass nun auch die Union sich nicht zu schade dafür ist, auf diese Weise gegen eine kritische Zivilgesellschaft zu Felde zu ziehen, hat eine beunruhigende neue Qualität. Das Vorgehen fügt sich nahtlos ein in eine Debattenkultur, die politische Auseinandersetzungen nicht mehr entlang von Sachfragen führt, sondern zunehmend kulturkämpferisch daherkommt.
Mit dieser Kleinen Anfrage setzt die Union in Bezug auf die kritische Zivilgesellschaft nicht nur den Ton für die neue Legislaturperiode, sondern stellt gleichzeitig auch das Bestreben infrage, mehr Rechtssicherheit für gemeinnützige Vereine zu schaffen. 2021 hatte sich die Ampel zwar auf eine Reform geeinigt, war damit aber gescheitert. Vage gehaltene Formulierungen im aktuellen Koalitionsvertrag wie „Modernisierung des Katalogs gemeinnütziger Zwecke“ lassen von der aktuellen Regierung diesbezüglich noch weniger erwarten.
Gemeinnützigkeit als anerkannte Basis gesellschaftlichen Handelns
Was vielen Menschen nicht klar ist: Gemeinnützigkeitsrecht ist Steuerrecht. „Gemeinnützig ist, wer die Allgemeinheit selbstlos fördert“ steht sinngemäß in der Abgabenordnung. Dieser Status beinhaltet viel mehr als nur Steuervorteile für Spender*innen und den Verein selbst. Er ermöglicht den Vereinen zum Beispiel Zugang zu kommunalen Räumlichkeiten zu vergünstigten Konditionen und ist häufig Voraussetzung für die finanzielle Förderung durch Drittmittelgeber wie Stiftungen. Der Status Gemeinnützigkeit ist ein breit anerkanntes Siegel für positives gesellschaftliches Wirken. Der Einsatz für Natur- und Klimaschutz, Jugendarbeit, Sport, Kunst, Kultur oder Verbraucher*innenberatung – das und vieles mehr ist von den gemeinnützigen Zwecken in der Abgabenordnung abgedeckt. In der Auflistung fehlen jedoch eine Reihe von ebenfalls zweifelsfrei Gemeinwohl fördernden Zwecken wie etwa Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.
Zudem hat der Bundesfinanzhof 2019 mit dem „Attac-Urteil“ die beiden Zwecke Förderung des demokratischen Staatwesens und der politischen Bildung deutlich verengt. Politische Bildung darf seitdem nur noch „in geistiger Offenheit“ stattfinden, wie auch immer Finanzbeamt*innen diese definieren. Das demokratische Staatswesen wird nach dieser Rechtsprechung nicht durch demokratisches Handeln an sich gefördert, der entsprechende Zweck erlaubt lediglich, die Funktionsweise unseres Staatswesens zu erläutern. Wer sich also politisch einmischt und keinen passenden Zweck zur Verfügung hat, läuft Gefahr, die Gemeinnützigkeit zu verlieren.
Das alles wird zunehmend zum Problem, denn konservative bis rechtsradikale Kreise nutzen sowohl die Lücken und Unsicherheiten im Gesetz als auch die Mär vom politischen Neutralitätsgebot, um Vereinen systematisch das Leben schwer zu machen. Sie stiften dazu an, vermeintlich parteipolitisch oder auch nur „politisch“ agierende Vereine bei den Finanzämtern anzuzeigen. Dabei verkennen sie zweierlei: Selbstorganisiertes Engagement ist essenziell für unsere Demokratie und zwar auch dann, wenn es unbequem ist, weil dessen Ziele (selbstverständlich!) nicht zwangsläufig mit denen von Parteien übereinstimmen. Es ist genau die Aufgabe solcher Organisationen, sich für unterrepräsentierte und schwach vertretene Gruppen und Anliegen einzusetzen – weil es sonst niemand tut. Und zweitens: Die Anwendung politischer Mittel ist Vereinen gestattet, so lange die eigenen Zwecke verfolgt werden. Im Anwendungserlass zur Abgabenordnung ist sogar festgelegt: Auch vereinzelte Stellungnahmen zu tagespolitischen Themen außerhalb der eigenen Satzungszwecke sind grundsätzlich erlaubt. Auf viele Vereine wirkt diese unklare Rechtslage dennoch verunsichernd und einschüchternd. Aus Angst vor dem Verlust ihrer Gemeinnützigkeit halten sie sich häufig unnötigerweise zurück und beschneiden sich und ihre Arbeit.
Mythos Neutralitätsgebot
Was hat es mit dem zunehmend häufig gegen NGOs ins Feld geführten Neutralitätsgebot auf sich? Kurz gesagt: Es ist ein großes Missverständnis. Im Gegensatz zu staatlichen Stellen sind zivilgesellschaftliche Akteure eben nicht zur Neutralität verpflichtet. Auch dann nicht, wenn sie für einzelne Projekte staatliche Fördermittel beziehen. Organisationen sind in ihrem Handeln frei, sie sind Grundrechtsträger, was zum Beispiel Meinungs- und Versammlungsfreiheit angeht, sie dürfen eine klare politische Haltung haben und diese, etwa bei Demonstrationen, sogar in zugespitzter Form äußern. Wie das Bundesverfassungsgericht mehrfach betont hat, ist es sogar die Aufgabe des Staates, eine „freie und offene Meinungs- und Willensbildung“ zu gewährleisten. Zwar verbietet das Gemeinnützigkeitsrecht zivilgesellschaftlichen Organisationen, parteiähnlich zu sein oder eine Partei direkt zu unterstützen – keineswegs jedoch müssen sie politisch neutral sein, denn das würde ihre gesellschaftliche Funktion ad absurdum führen.
Und nun?
Unsere Demokratie steht unter Beschuss. Anstatt die unabhängige Zivilgesellschaft einzuschränken, muss das Engagement für unsere zentralen Grundwerte besser unterstützt werden. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Gesetzgeber, das Gemeinnützigkeitsrecht ins 21. Jahrhundert zu bringen – ganz im Sinne der vielfach beschworenen wehrhaften Demokratie!
Stephanie Handtmann ist geschäftsführende Vorständin der Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“, einem Zusammenschluss von über 220 Vereine, Organisationen und Stiftungen. Die Allianz setzt sich für ein modernes Gemeinnützigkeitsrecht ein.
Veranstaltungshinweis:
Gemeinnützigkeit und der Mythos des Neutralitätsgebots
04.09.25, 19:00 – 22:00
Sozial-Ökologisches Zentrum
https://latscher.in/events/2025-09-04-gemeinnuetzigkeit-und-der-mythos-des-neutralitaetsgebots