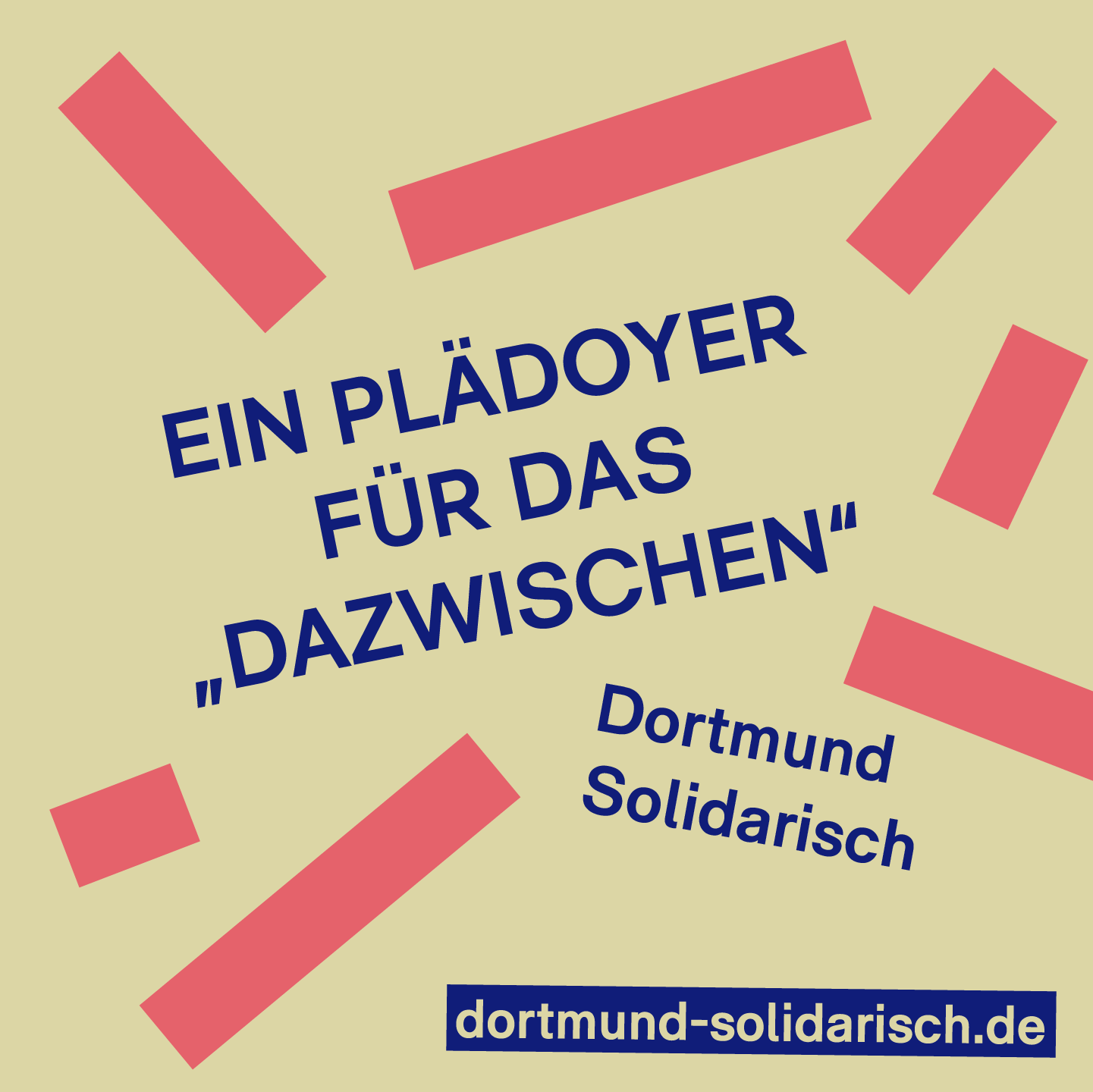Dieser Artikel ist Teil unserer Zeitung zur Kommunalwahl 2025.
Autor*in: Dortmund Solidarisch
Über den Status Quo, die Revolution und das „Dazwischen“ – Einige Gedanken zu einem nüchternen Verhältnis zum Wählen
Werden wir die systemischen Ungerechtigkeiten, in denen wir leben müssen, abschaffen, indem wir das „richtige“ Kreuzchen auf dem Wahlzettel machen? Vermutlich nicht. Lösen wir von heute auf morgen Welthunger, Klimakrise und Kriege, indem wir unsere Stimmen abgeben? Auch das scheint ziemlich unwahrscheinlich. Aber es gibt da noch etwas zwischen dem Status Quo, der nicht nur Migrant*innen, arme Menschen, Frauen und Queers in einen ewigen Existenzkampf zwingt, und der ganz großen Revolution, nach der das schöne Leben für alle in greifbarer Nähe ist.
Zur Wahrheit dieses Status Quo gehört, dass wir überall mit einem Erstarken rechter Politiken konfrontiert sind. Seien es Nazi-Banden, rechtsextreme Parteien wie die AfD oder ein Bundeskanzler, der ganz ungeniert gegen Migrant*innen, Queers und Arme hetzt – sie alle arbeiten daran, die Grenzen des Sag- und Machbaren zu verschieben und planen schon die nächsten Schweinereien. Dem müssen wir als Gesellschaft etwas entgegensetzen. In erster Linie heißt das, sich zusammenzutun, den Widerspruch sichtbar zu machen und auf die Straße zu gehen: für eine andere Welt, für ein solidarisches Miteinander und dafür, die Verhältnisse umzukrempeln.
Über das „Dazwischen“
Doch dieses „Dazwischen“, zwischen Status Quo und dem guten Leben für alle, ist das eigentlich Spannende: Denn das bedeutet die spürbare Verbesserung der Lebensbedingungen eines vieler Menschen. Wenn wir Wohnungskonzerne entmachten, damit Menschen sich die Mieten wieder leisten können, oder für die rechtliche Anerkennung und Unterstützung von trans Menschen kämpfen, dann hilft das ganz konkreten Menschen. Wenn wir uns für die Öffnung der Grenzen, für Seenotrettung und Bleibeperspektiven für Migrant*innen einsetzen, dann rettet dieses Engagement Leben. Den Klimaschutz in allen gesellschaftlichen Bereichen voranzutreiben heißt, eine Chance auf eine lebenswerte Existenz auf diesem Planeten zu erhalten.All diese Themen sind Themen der sozialen Bewegungen – ganz egal, ob es darum geht, konkrete Verbesserungen zu erkämpfen oder sich gegen Schweinereien zur Wehr zu setzen. Doch genau dort, wo Bewegungen wirksam werden, geraten sie oft in ein Spannungsverhältnis: Einerseits braucht es Einfluss auf staatliche Entscheidungen, um reale Veränderungen durchzusetzen. Andererseits wissen viele Aktivist*innen nur zu gut, dass der bürgerliche Staat Ausdruck jener Ordnung ist, die sie kritisieren. Diese Ambivalenz nicht aus den Augen zu verlieren, ist der entscheidende Moment.
Die traurige Wahrheit ist wohl auch, dass soziale Bewegungen ohne konkrete Ziele – und ohne zumindest punktuelle Einflussnahme auf staatliches Handeln – oft in sich zusammenfallen oder gar nicht erst an Fahrt gewinnen. Hier schließt sich der Kreis zur Eingangsfrage: Was lässt sich mit einem Kreuz verändern? Können progressive Kräfte in den Parlamenten soziale Bewegungen dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und materielle Verbesserungen zu erkämpfen? Vermutlich schon. An diesem Punkt öffnet sich ein Raum für strategisches Handeln: Protest auf der Straße und Einflussnahme im Parlament schließen sich nicht aus – im Gegenteil. Wenn es gelingt, beide Ebenen miteinander zu verbinden, unter Anerkennung aller Ambivalenzen, kann daraus eine kraftvolle Verbindung entstehen: Bewegungen, die Druck von unten erzeugen – und parlamentarische Kräfte, die diesen Druck aufnehmen, übersetzen und Räume für Veränderung öffnen. Beide Sphären folgen unterschiedlichen Logiken, aber sie müssen sich nicht ausschließen. Im besten Fall verstärken sie sich gegenseitig.
Gegenmacht organisieren
Gegenmacht organisieren heißt, nicht darauf zu vertrauen, dass Parlamente unsere Probleme lösen – aber auch nicht, hier den Menschenfeinden und Demagogen kampflos das Feld zu überlassen. Es bedeutet, Mehrheiten in der Gesellschaft zu verschieben, radikale Forderungen anschlussfähig zu machen – und sie dort zu platzieren, wo sie Machtverhältnisse herausfordern: im Alltag, auf der Straße, aber eben auch in den Parlamenten.
Werden wir stärker, wenn progressive Parteien an der Wahlurne scheitern? Sicher nicht. Tatsächlich schränkt es die Handlungsfähigkeit von Bewegungen ein. Der Preis für dieses Scheitern ist nicht nur symbolisch – er ist ganz konkret: für Mieter*innen, Geflüchtete, Queers, Klimaaktivist*innen und alle, die auf soziale Kämpfe angewiesen sind. Dementsprechend ist ein Plädoyer für das „Dazwischen“ auch ein Plädoyer für ein nüchternes, ein abgeklärtes Verhältnis zum Wählen.
Demokratie verteidigen?
Die Vorstellung, dass Wählen und soziale Bewegung ein Entweder-Oder bilden, ist so naiv wie kurzsichtig. Ein taktisches Verhältnis zur Wahl erkennt die unterschiedlichen Logiken beider Sphären an – ebenso wie ihre Ambivalenzen und Widersprüche. Es heißt: Räume zu nutzen, ohne sich ihnen zu unterwerfen. Kämpfe im Parlament zu führen, ohne die Straße aufzugeben. Und die Hoffnung auf Veränderung dort zu nähren, wo sie real werden kann – im „Dazwischen“.
In den Kämpfen um die materielle Verbesserung der Lebensbedingungen kann auch die Hoffnung keimen, die Verhältnisse umzukrempeln. Dieses „Dazwischen“ verteidigt nicht die Demokratie der „reichen, weißen, cis, hetero, endo(?), gebildeten Männer“ – sondern sucht nach anderen Formen des Zusammenlebens. Es schafft Raum für Ambivalenz, für Widerstand, für das, was noch nicht ist – aber sein könnte.